Nicht lieferbar
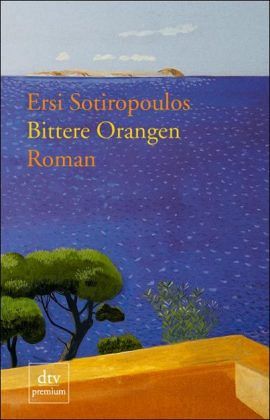
Bittere Orangen
Roman. Aus d. Neugriech. v. Doris Wille
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Eine ungewöhnliche Geschwisterbeziehung steht im Zentrum dieses gefeierten Romans der griechischen Autorin Ersi Sotiropoulos.Lia, eine junge Frau um die dreißig, liegt schwerkrank im Krankenhaus. Sie leidet unter dem rücksichtslosen Krankenpfleger Sotiris und bittet ihren Bruder Sid, an ihm Rache zu nehmen. Es gelingt Sid, sich in das Leben des Krankenpflegers einzuschleichen, und die beiden Männer verbringen gemeinsam einige Zeit in Sotiris' Heimatdorf. Dort kommt alles anders als geplant: statt seine Schwester zu rächen, vereitelt Sid im letzten Moment einen Mordplan des Krankenpflegers...
Eine ungewöhnliche Geschwisterbeziehung steht im Zentrum dieses gefeierten Romans der griechischen Autorin Ersi Sotiropoulos.
Lia, eine junge Frau um die dreißig, liegt schwerkrank im Krankenhaus. Sie leidet unter dem rücksichtslosen Krankenpfleger Sotiris und bittet ihren Bruder Sid, an ihm Rache zu nehmen. Es gelingt Sid, sich in das Leben des Krankenpflegers einzuschleichen, und die beiden Männer verbringen gemeinsam einige Zeit in Sotiris' Heimatdorf. Dort kommt alles anders als geplant: statt seine Schwester zu rächen, vereitelt Sid im letzten Moment einen Mordplan des Krankenpflegers.
Lia, eine junge Frau um die dreißig, liegt schwerkrank im Krankenhaus. Sie leidet unter dem rücksichtslosen Krankenpfleger Sotiris und bittet ihren Bruder Sid, an ihm Rache zu nehmen. Es gelingt Sid, sich in das Leben des Krankenpflegers einzuschleichen, und die beiden Männer verbringen gemeinsam einige Zeit in Sotiris' Heimatdorf. Dort kommt alles anders als geplant: statt seine Schwester zu rächen, vereitelt Sid im letzten Moment einen Mordplan des Krankenpflegers.



